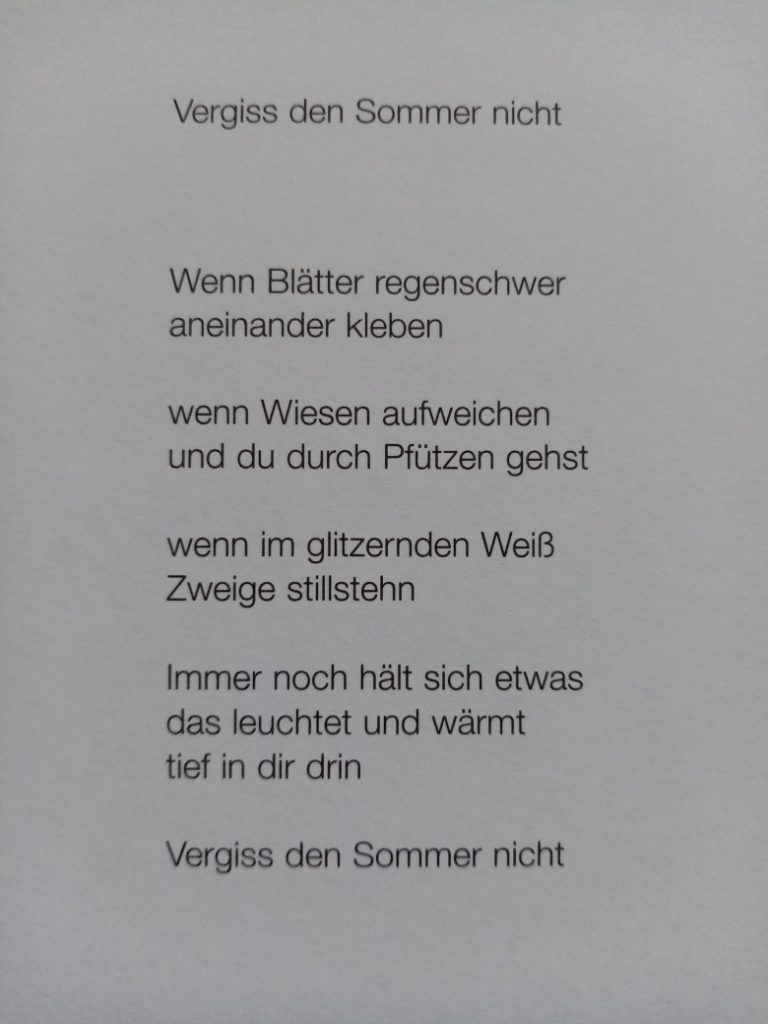Die ersteigerte Bibel
Im Jahr 1817 heiratete im Bergischen Land im Ort Witzhelde der Schuhmacher Arnold Breidenbach seine Frau Friederike. Er hatte 200 Silbertaler und konnte damit ein kleines Anwesen erwerben. Es herrschte große Armut, weil das Land unter der Franzosenherrschaft von Napoleon Bonaparte gelitten hatte. Arnold Breidenbach war ein frommer Mann. Leider fand er im ganzen Dorf keinen Gesinnungsgenossen. Er verdiente etwa acht Groschen am Tag und konnte ein wenig für den Sparstrumpf zurücklegen. Das Ehepaar bekam einen Sohn, der mit den Eltern im einzigen Bett schlief. Dann kam das zweite Kind. Es lag noch in der Wiege, stieß aber mit Kopf und Füßen oben und unten an. Das dritte Kind war unterwegs.
Eines Tages gab es die Gelegenheit, ein Bett in der Gaststätte zu steigern. Arnold Breidenbach nahm die ersparten 17 Taler mit und ging in die Gastwirtschaft. Die Auktion begann. Das erste, was zur Versteigerung kam, war eine Bibel, etwa 120 Jahre alt und 7 kg schwer. Die anderen Besucher begannen Witze darüber zu machen. Arnold Breidenbachs Herz krampfte sich zusammen und er bot einen Taler für die Bibel. „Hochtreiben“ raunten sich die Leute zu. Der Schuhmacher bot immer mit. Schließlich erhielt er bei 17 Talern den Zuschlag. Still nahm er seine Bibel und ging nach Hause. Als er dort ankam, war die erste Frage seiner Frau. „Was hast du denn da?“ „Eine Bibel“. „Und wo ist das Bett?“. „Ich habe kein Bett“. „Warum nicht?“ „Wegen der Bibel“. „Wie teuer war die Bibel?“ „17 Taler!“. Seine Frau antwortete mit Vorwürfe und Argumente. Er antwortete: „Ich hab es nicht ertragen, wie sie das heilige Buch verspottet haben“. Der Haussegen hing an diesem Tag schief!
Am nächsten Tag erschien in aller Frühe ein Müller aus der Nachbarschaft. Er kratzte sich verlegen an den Kopf und sagte: „Die Sache ist so. Ich komme wegen der Bibel und dem Bett. Als ich meiner Frau gestern die ganze Geschichte erzählt habe, hat sie mir gehörig den Kopf gewaschen. „Immer müsst ihr Männer spotten, wenn ihr getrunken habt“, hat sie gesagt. Den ganzen Abend hat sie mir keine Ruhe gegeben und mir gepredigt. Und heute in aller Frühe hat sie mich geweckt. Die ganze Nacht habe sie nicht geschlafen, sagte sie. Ich solle aufstehen und mit dem Knecht ein Bett aus der Gesindestube, das nicht gebraucht werde, zu euch bringen. Sie hat noch Stroh geschnitten und neue Bettwäsche aufgezogen. Bitte, seid so freundlich und nehmt das Bett, sonst bekomme ich keine Ruhe“.
Arnold Breidenbach hatte inzwischen seine Frau herzugerufen. Nun schauten sich beide an, und Frau Breidenbach ging hinaus und machte es wie seinerzeit Petrus – sie weinte. Das Bett wurde abgeladen und in der Kammer aufgestellt. Am Abend las Arnold Breidenbach seiner Frau aus Psalm 37: „Habe deine Lust an dem Herrn, der wir dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege, und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen“.